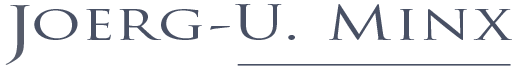Fortschreibung der Arbeit
Stand: 01. Februar 2014
4. »Die Beziehungen zwischen musikalischer Ratio und musikalischem Leben gehören zu den historisch wichtigsten variierenden Spannungsverhältnissen in der Musik« – Das musiksoziologische Fragment
a) Einleitung
Das Musizieren 1 kann eine Sache auf Leben und Tod sein: Weber schildert in seinem Fragment Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik 2 , daß in der stark stereotypisierten, der Magie unterstellten primitiven Musik Sänger mit dem Tode bestraft wurden, wenn sie falsch sangen (MS, S. 833). Dieses anschauliche Beispiel erhellt, daß es sich auch in der Musik um ein – mehr oder weniger – subjektiv sinnvolles Handeln von Menschen handelt (WuG, S. 1 f.), um soziale Beziehungen (WuG, S. 13 f. ) – mit anderen Worten: um soziale Phänomene, die von der Soziologie im Sinne eines handlungstheoretischen Ansatzes verstehend erklärt werden können (vgl. WuG, S. 1). Mag es hier auch – worauf die geistes – wissenschaftlich orientierte, von der Hermeneutik Diltheys herkommende Musiktheorie gegenüber der Soziologie immer insistiert hat – in Analogie zum religiösen Handeln Formen des Handelns geben, die sich dem Verständnis dauerhaft
entziehen (vgl. dazu etwa (RS I, S. 111 f. Anm. 4): 3 die soziologische Analyse findet auch in der Begegnung zwischen dem künstlerisch Schaffenden (dem Musikproduzenten; vgl. RS I, S. 555) und dem Musikkonsumenten (dem „ästhetisch erregten Rezipierenden;“ RS I, S. 556), also im Musikerlebnis (so Silbermann 1979, S. 203) ein soziales Geschehen. Diesem hat sich Weber wiederholt, wenn auch nur hier im Zusammenhang, zugewandt. 4 In einem Diskussionsbeitrag auf dem ersten Soziologentag 1910 in Frankfurt / Main hat er selbst – mit Blick auf die Bedeutung des großstädtischen Lebens für die Ku nst und die Bedeutung der Technik in ihr – das Verhältnis zwischen Musikwissenschaften und Soziologie so bestimmt:
„Denn auf diesem Problemgebiete gehört in die Musikgeschichte, und nur in sie, die Frage der Beziehung zwischen künstlerischem Wollen und mus iktechnischem Mittel. In die Soziologie dagegen die andere Frage nach der Beziehung zwischen dem »Geist« einer bestimmten Musik und den das Lebenstempo und die Lebensgefühle beeinflussenden allgemeinen technischen Unterlagen unseres heutigen, zumal wiederu m unseres großstädtischen Lebens.“ (SP, S. 455).
Und so ist das musiksoziologische Fragment, 5 ein schier unerschöpflicher Steinbruch für fast alle relevanten Fragen der Musikwissenschaft und – soziologie 6 , das einzige zusammenhängende Zeugnis für Webers Sicht der Rationalisierungsprozesse auf dem Gebiet der Musik. –
3 Vgl. hierzu auch Silbermann (1963, S. 463): „Ebenso wie Webers Religionssoziologie der Gedanke durchzieht, daß religiöses Verhalten nicht als sozial anzusehen ist, solange es im Zustand innerer Kontemplation verbleibt, ebenso steht hinter den Erläuterungen zu der durch die Entwicklung des Instrumentenbaus hervorgerufenen fortschreitenden Rationalisierung der Gedankengang, daß eine Musik, die unsing – o der unspielbar ist, eine Musik, die sich nicht transponieren läßt oder, wenn sie gesungen wird, kein adäquates Begleitinstrument finden kann oder sich schriftlich nicht fixieren läßt, nicht sozial ist, da ihr dadurch die Möglichkeit entzogen wird, mit dem Verhalten dritter Personen in Verbindung zu treten.“ 4 Weber war Kunstkenner (Literatur, Architektur, Malerei; vgl. etwa SP, S. 452 u.ö.) und erweist sich insbesondere in der vorliegenden Schrift nicht nur als umfassender Musikkenner, sondern auch als Musi ktheoretiker auf der Höhe seiner Zeit; daneben hat er auch selbst musiziert (Braun 1992, S. 22). Und auch seine Tantengeschichten (so Winckelmann, zit bei Kaesler 1989, S. 36) – ein Beleg für die enge Beziehung zwischen Werk und Biographie – spielen in die sem Zusammenhang eine wohl nicht unerhebliche Rolle: in der Forschung wird häufiger (so etwa Braun 1992, S. 13) die naheliegende Vermutung geäußert, daß insbesondere die Freundschaft zur Pianistin Mina Tobler, die in dieser Zeit begann und bis zu Webers Le bensende andauerte, die musiksoziologischen Arbeiten erheblich beflügelt habe. 5 Entstanden ist die Schrift zwischen 1910/11 (Kaesler 1998, S. 215, Silbermann 1963, S. 448) oder aber zwischen 1912/13 (so Braun 1992: 13; vgl. auch Schluchter 1988b, S. 567); sie ist ein essayistisches Fragment (Silbermann 1963, S. 448), die einzelnen Abschnitte sind teilweise übergangslos aneinandergehängt. Die Überschrift stammt nicht von Weber selbst (Braun 1992, S. 12). 6 Daß Webers Musiksoziologie chronisch abseits der so ziologischen Betrachtung liegt (vgl. Braun 1992, S. 11 f.; Schluchter 1988b, S. 566 ff.; Schluchter beschäftigt sich allein unter werkgeschichtlichen Aspekten mit der Schrift), hängt sicherlich auch mit dem Gegenstand der Schrift zusammen; aber nicht nur: die Schrift gilt aufgrund ihres skizzenhaften, unvollendeten Charakters selbst über das für das gesamte c.w. geltende Maß hinaus als schwierig (vgl. dazu Braun 1992, S. 140). Entsprechend schmal ist die Sekundärliteratur; die wechselvolle Editionsgeschicht e der Schrift (vgl. dazu Silbermann 1963, S. 449) ist so gesehen eher Symptom als Grund der Nichtbeachtung.b) Zur Bedeutung der Schrift im Schrifttum Webers
Keine Analyse des Weberschen Rationalitätsbegriffs kann an dieser Schrift vorbeigehen, und dies gleich aus mehreren Gründen: zunächst einmal bietet das Fragment in einer quantitativen Analyse des Wortfeldes »*rational*« einen hohen absoluten Zähler (131 Belege) sowie einen bis dato hohen relativen Zähler:
| Worte: | 29.084 |
| Suchwort rational*: | 82 |
| Maßzahl: | 2,82 |
| Suchwort *rational*: | 131 |
| Maßzahl: | 4,50 |
Man kann geradezu sagen: ab dieser Schrift gewinnen die relativen Zähler eine neue Qualität : bewegten sie sich vor 1910 im Promille – Bereich, so liegen sie ab dem zweiten Durchbruch im Prozent – Bereich. Allerdings: dieses Niveau ist hier erst zur Hälfte erreicht.
Hinzu kommen sachliche Gründe: Weber hat der Schrift selbst hohe Bedeutung zugemessen (vgl. Braun 1992, S. 11) und sich bis zu seinem Ableben mit der Musiksoziologie beschäftigt (Braun 1992, S. 132 f.): mehrfach nahm er später auf die Schrift Bezug – und zwar gerade an solchen Stellen, die für das Verständnis des c.w. entscheidend sind, wie z.B. in der Vorbemerkung zu den Gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie (RS I, S. 2; vgl. Kaesler 199 8, S. 215; Schluchter 1988b, S. 567 f.) oder aber der Zwischenbetrachtung (RS I, S. 554 ff.); die Arbeit gehört zu einem auf die Vorkriegszeit zurückgehenden, dann aber nicht realisierten Plan einer alle Künste umfassenden Soziologie (vgl. Lebensbild, S. 5 07), in der Weber insbesondere die irrationalen Lebenssphären daraufhin untersuchen wollte, inwieweit auch sie einem Prozeß der Rationalisierung unterliegen. – Die Schrift beinhaltet nach Schluchters Hypothese den „zweiten Durchbruch“: wiederum untersucht W eber eine typisch irrationale Lebenssphäre wie bereits in der Protestantismusschrift von 1904, jetzt aber entdeckt er Rationalisierungsprozesse zu allen Zeiten, an allen Orten ; vom Glissando – Geheul in der primitiven Musik (MS, S. 831) bis hin zur modernen Atonalität der Wiener Schule , von der Pentatonik in westfälischen Kinderliedern (MS, S. 823) bis hin zur Musik der Chippewah – Indianer öffnet sich Webers Horizont. Es wird hier erstmalig Webers kulturvergleichende Methode in extenso praktiziert, die er – m it Blick auf die Soziologie der Stadt – in einem Brief an Georg von Below (vgl. MWG I/19: 16 f.) 1914 so umschrieben hat:
„… das, was der mittelalterlichen Stadt spezifisch ist, … ist doch nur durch die Feststellung: was andern Städten (antiken, chine sischen, islamischen) fehlte, zu entwickeln“.
Insofern muß man hier also von einer erheblichen Ausweitung der Rationalitätsthese sprechen. – Und noch etwas: es gibt im Fragment auffällige Parallelen zur Religion, und zwar sowohl hinsichtlich der Sphären selbst 7 als auch hinsichtlich der Behandlung beider Sphären durch den Forscher Weber. 8
7 Vgl. etwa RS I, S. 554: „Mit der ersteren [= der ästhetischen Sphäre der Kunst; jum] steht die magische Religiosität in intimster Beziehung.“ 8 Vg l. etwa Braun 1992, S. 96. Kaesler (1998, S. 216) schreibt: „Gerade wegen ihrer vermeintlichen „Irrationalität“ reizte ihn die Fragestellung, wie weit auch im Bereich der „Kultur“ dieser Prozeß nachzuweisen sei; diese Hypothese ist das Grundthema des Fragm ents zur Musiksoziologie.“ – Die angebliche Irrationalität der Musik ist allerdings die spezifische Sicht der romantischen Schule; inwieweit Weber ihr verhaftet war, ist umstritten. Braun (1992, S. 21 ff.) sieht Weber in der romantischen Musiktradition angesiedelt; dagegen schreibt Silbermann (1963, S. 460 f.): „[Musik hat Weber besonders gereizt; jum], weil es angesichts seiner „Irrationalität“ näch gängigen Auffassungen, insbesondere nach denen der romantischen Schule, die ja in der ersten Hälfte von Webers Leben die Musik noch beherrschten, sich jedweder rationalen Erfassung zu entziehen scheint. Daß er sich selbst in seinem persönlichen Verhältnis zur Musik weitgehend von den romantisierenden Darstellungen der Musik als sogenannter „zarter Schauer der Seele“ oder als Hegelsche „Kunst der Innerlichkeit“ entfernt hatte, beweisen einige seiner Briefstellen, in denen er von Konzerteindrücken berichtet.“c) Der Inhalt des musiksoziologischen Fragments
Es geht im folgenden nicht primär um eine Darstellung des Inhaltes der Schrift; aber gerade hier fallen wichtige Entscheid ungen über das Rationalisierungsverständnis in der Schrift: die evolutionäre Perspektive, die etwa Kaesler (1998, S. 216 f.) 9 und Silbermann (1963, S. 459) in der Schrift entdecken, ist nämlich ex post aus der Vorbemerkung (vgl. RS I, S. 2) an das Fragment herangetragen – und dann auch nur zur Hälfte zutreffend: eine sorgfältige Analyse der Vorbemerkung würde nämlich erweisen, daß nicht die simple Problemstellung okzidentale Rationalisierung hie – orientale Irrationalität d ort Webers Anliegen ist, sondern vielmehr die spezifische Eigenart des modernen Rationalismus (vgl. bes. RS I, S. 11!). – Demzufolge sei hier summarisch der Inhalt dieses außerordentlich detailreichen Aufsatzes beschrieben.
Vor allem ist wichtig zu sehen, daß die Darstellung über weite Passagen hinweg eine Auseinandersetzung mit der Tonphysiologie von Hermann v. Helmholtz 10 beinhaltet; m.a.W.: Weber sucht hier gegenüber den ästhetisierenden Tendenzen der Musikwissenschaft seiner Zeit einen klaren (positivistischen) Standpunkt: er will auch hier empirische Forschung betreiben! – Silbermann (1963, S. 459) hat den Inhalt des Fragments folgendermaßen zusammengefaßt:
9 Kaesler 1998 kann man nicht als selbständiges Votum behandeln: er hat nämlich die Passage bei Silbermann 1963 (S. 459) abgeschrieben; Kaesler 1998 ist jedem, der seine Darstellung von 1978 kennt, eine herbe Enttäuschung! 10 Vgl. dazu: Helmholtz, Hermann von (1863): Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik. Brauns chweig (versch. Aufl.).„Zusammengefaßt und auf einen einfachen Nenner gebracht, stellt Weber gegenüber: das Prinzip der si mplen Distanz von Tönen untereinander und das Prinzip der Akkordharmonik, das Ganze evolutionär gesehen. War die treibende Kraft hinter dem Distanzprinzip Zweckmäßigkeit, reine Praxis, so war sie bei der Akkordauffassung Ausdruck eines ästhetischen Bedürfnisses. Die Entwicklung beider Prinzipien dient dazu, Irrationalitäten soweit wie möglich auszuscheiden; sie sind also Zeichen der rationalen Mentalität einer Gesellschaft, selbst wenn eine völlige Rationalisierung sich insofern nicht durchführen ließ, als die unsymmetrische Stellung gewisser Töne, der Septime zum Beispiel, Irrrationalitäten in sich birgt. Aber selbst wenn die Systeme der westlichen Musik nur unvollständig rationalisiert sein sollten, sind sie zumindest durch ein Streben nach Rationalität g ekennzeichnet, während, so weist Weber nach, bei den primitiven und orientalischen Musiken diese Beziehung gar nicht oder kaum zutage tritt …“ (Hervorhebung im Text; jum). –
Diese Interpretation bleibt nicht ohne Bedenken. Zunächst einmal dies: indem Silbermann den Text von der Idee vom zweckrationalen Handeln (a.a.O., S. 460) her interpretiert, trägt er – aus WuG – eine Formulierung ein, die dem Text selbst nicht zu entnehmen ist. Gewichtiger sind inhaltliche Einwände: so ist z.B. nach Weber auch die sog. temperierte Stimmung objektiv als eine simple Distanzskala auffassen; vgl. MS, S. 860), vor allem aber unvollständig: denn Weber untersucht in der Schrift nicht nur Rationali sierungsprozesse, sondern zugleich auch Irrationalisierungsprozesse : er sieht sie etwa in der Entwicklung der Kunstmusik , wie sie sich im Schicksal der hellenistischen Musik zeigen (MS, S. 844). Vor allem aber sieht er in der Entwicklung der arabischen Musik, die den ganzen vorderen Orient (mit Ausnahme der jüdischen Synagoge) beeinflußte, und auch in der basikischen Musik genau die entgegengesetzte Entwicklung wie im Okzident: während sich hier aufgrund der Polyphonie in Verbindung mit der rationalen Noten schrift eine strenge Diatonik entwickelte, wurde die arabische Musik aufgrund des Auftretens von Berufsmusikern – und damit vermehrten ästhetischen Bedürfnissen – bei gleichzeitigem Fehlen sowohl von Mehrstimmigkeit als auch der Notenschrift der entgegenge setzte Effekt erzielt: zunehmende Irrationalität, die sich in irrationalen Intervallen in den Skalen äußerte (MS, S. 855 f.):
„ Für das Maß der Überwucherung der tonalen Bestandteile durch neuentstehende melodiöse Ausdrucksbedürfnisse gibt es eben keine fes te Schranke, sobald der feste Halt der typischen Tonformeln verlassen ist und der Virtuose oder der auf den Virtuosenvortrag hin geschulte Berufskünstler Träger der Musikentwicklung wird“ (MS, S. 855 f.).
Das aber bedeutet: Rationalität und Irrationalität sind zugleich Max Webers Thema in dieser Schrift, erst beides zugleich erweist das – im Vergleich! – höhere Ausmaß von Rationalität in der Musik des Okzident. Unmißverständlich hat Weber diesen Sachverhalt später in der Werturteilsschrift von 1917 formuliert:
„Daß subjektiv fortschreitend rationaleres Handeln zu objektiv »zweckmäßigerem« Handeln führt, ist nur eine von mehreren Möglichkeiten und ein mit (verschieden großer) Wahrscheinlichkeit zu erwartender Vorgang.“ (WL, S. 488).
d) Webers Verständnis vo n Rationalisierung im musiksoziologischen Fragment
Es sei an dieser Stelle Webers Verständnis von Rationalität an der Schrift selbst erhoben. Schon im ersten Satz der Schrift fällt der Ausdruck „harmonisch rationalisierte Musik“ (MS, S. 5); er nimmt ein wi chtiges Teilergebnis der Studie vorweg. Was ist unter diesem Begriff zu verstehen? Weber geht aus von den akustischen Phänomenen zur Tongewinnung innerhalb des okzidentalen akkordharmonischen Musiksystems; was er hier deduktiv anhand der diversen Teilungsv ersuche der Schwingungszahlen von Tönen nachvollzieht, haben die Musiker – die ja in der Regel nicht Mathematiker und nicht Physiker waren – praktisch realisiert: etwa anhand des sog. Monochords (MS, S. 842 u.ö.; vgl. dazu Grabner 1970, S. 48 f.), einer üb er einen Resonanzboden gespannte Saite mit verschiebbarem Steg, häufig auch mit einer Meßlatte versehen. Durch die verschiedenen Teilungsverhältnisse der Saite wird hier das Tonmaterial gewonnen – eine Halbierung der Saite, also ein Schwingungszahlverhältn is von 1/2, ergibt die nächsthöhere Oktave zur Grundschwingung, ein Teilungsverhältnis von 2/3 ergibt die reine Quinte usw. Entscheidend ist nun: auf diese Weise läßt sich keine rationale Skala (i.e.: eine Skala mit gleichen Abständen zwischen den reinen E inzeltönen, die also transponierbar ist!) gewinnen. – Und auch die andere Weise der Gewinnung von Tonmaterial, nämlich die Stimmung von Saiten über die Quinten – bzw. Quartenzirkel – schon Pythagoras zugeschrieben, heutzutage jedem Klavierstimmer vertraut, e rzeugt keine Töne, die von den Schwingungszahlen her Oktavparallelen 64 erzeugen. 11 Dasselbe Ergebnis zeigt sich auch von der Saitenteilung her. Dieser Sachverhalt, der – wie Weber zeigt – im Laufe der Zeit in den verschiedenen Kulturen zu ganz unterschiedlic hen Versuchen der Temperierung führte, bildet für ihn die „Grundtatsache[.] aller Musikrationalisierung“ (MS, S. 818). – Rationalisierung bedeutet in diesem Zusammenhang also zuallererst: Ordnung des Tonmaterials durch seine mathematische Erschließung (MS, S. 818) – und nicht etwa dadurch, daß man symmetrische Löcher in Pfeifen bohrt (vgl. etwa MS, S. 858)! Diese Form von Rationalisierung erfolgte zuallererst in der Musiktheorie der Griechen.
Rationalisierung – das wird so nicht unmittelbar deutlich bei Web er – wird erforderlich primär durch die praktischen Anforderungen des gemeinsamen Musizierens, insbesondere auf unterschiedlichen Instrumenten: eine irrationale Skala ist unproblematisch, solange ein einzelner Musiker allein spielt – und die Tonart nicht w echselt. 12 Sobald aber zwei Musiker auf unterschiedlichen Instrumenten gemeinsam musizieren, stellt sich sofort das Problem der Skalen und der Transposition ; bereits die griechische Skalenlehre bezeugt dieses Problem. – Jeder Musikpraktiker kennt nun das lei dige Problem der Stimmungen : Tasteninstrumente sind temperiert gestimmt, Streicher sind rein gestimmt, Blasinstrumente besitzen – häufig unveränderbare – Naturtöne – all diese Umstände gestalten das Konzertieren bis auf den heutigen Tag allein schon von der technischen Seite her schwierig. – Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde: auch die Welt der Töne ist ein irrationales „Chaos regelloser Willkür“ (MS, S. 830; da s ist nicht zu verwechseln mit der angeblich primitiven Musik!). Es gilt dieser Sachverhalt in vielerlei Hinsicht:
- Die Abgrenzung von Tönen gegenüber Geräuschen: regelmäßige Schwingungen vs. unregelmäßige Schwingungen;
- Der einzelne Ton (nach Lautstärke un d Schwingung, i.e.: hörbar vs. unhörbar; nach Obertönen (= unterschiedliche Instrumente): Klänge!
- Die Bezeichnung von Tönen und damit zugleich: die Festlegung von Tonhöhen;
- Die Teilung der Oktave und die Gewinnung von Tonmaterial durch Tonschritte – was so selbstverständlich nicht ist, wie es uns heute erscheint;
- Die Festlegung von Distanzen zwischen 2 oder mehreren Tönen; vgl. dazu allein das Glissando – Geheul (MS, S. 831) in der primitiven Musik! Dann aber vor allem die unterschiedlichen Versuche der Glied erung von Tetrachorden in der griechischen und byzantinischen Musik;
- Die Deutung der Distanzen (akkordharmonisch vs. distanzmäßig) – ein Problem, das lange Zeit insbesondere bei der Terz ungelöst war;
- Die Festlegung von Tonsystemen (Skalen, Modi, Tonleiter n usw.);
- Die Erweiterung des Tonmaterials durch die Harmonik durch Tonfolgen und – leitern ( essentielle Tonleitern : MS, S. 834 vs. akzidentielle Tonleitern – also Tonfolgen ohne einen Grundton wie etwa die sog. Kirchentonleitern);
- Die Spannung zwischen Harm onik und Melodik, also die Erweiterung des Tonmaterials durch die Melodik unter Verwendung von harmoniefremden Tönen, usw. …
Zutreffend formuliert Braun (1992, S. 141):
„Nicht nur das organisch begrenzte menschliche Hörvermögen wählt aus diesem unbesch ränkten Tonvorrat aus, sondern auch und vor allem das, was je nach Kultur und Tradition ‘sinnvoll‘ erschient und erscheint – sei es aus praktischen Gründen einer leichten Sing – und Spielbarkeit, sei es aus emotionalen oder kultisch – religiösen, aus zahlensy mbolischen Motiven oder aus mathematischer Experimentierfreude. In Anlehnung an Webers »Kultur« – Begriff läßt sich ein Tonsystem in diesem selektiven Sinn als ein historisch – kulturell bedingter, »mit Sinn und Bedeutung bedachter endlicher Ausschnitt aus der sinnlosen Unendlichkeit« des Tonvorrates ‘an sich‘ bezeichnen (WL, S. 170).“
Dies ist der Inhalt der Musikrationalisierung (MS, S. 818): Auswahl und Ordnung einer irrationalen Vielfalt von Tönen, wobei sich die europäische Form der Rationalisierung im V ergleich der Kulturen untereinander als ein Sonderweg erweist – zugleich aber als eine Einengung des Spielraumes und somit als Verlust von (musikalischer) Freiheit . Weber unterscheidet hierbei eine äußere – also durch den Instrumentenbau bedingte (MS, S. 8 22. 832) – Form der Rationalisierung, wie sie vor allem in Asien zu finden ist, von einer inneren , durch die Ordnungsprinzipien der Musiktheorie bedingten (MS, S. 858).
Die rationalen Grenzen des okzidentalen Tonsystems
Er entwickelt nun (MS, S. 818 f. 83 5 ff.) die zwölfstufigen bekannten diatonischen – also: auf Tonleitern basierenden – und chromatischen Tonleitern, unsere heutige Unterscheidung in Dur und Moll sowie das Prinzip der Tonalität 13 – also die Bezogenheit auf ein tonales Zentrum sowie die funkt ionalen Beziehungen zwischen den einzelnen Tönen einer Leiter – mit ihrer grundlegenden Unterscheidung zwischen Konsonanten und Dissonanzen . Es gibt hier Grenzen der Rationalisierung. Zum einen systemimmanent: und hier vor allem durch die Moll – Septime bedi ngt (MS, S. 819 f.), was zur heutigen Unterscheidung zwischen natürlich Moll (= äolisch), harmonisch Moll mit erhöhter 7. Stufe (= Durmoll ) sowie melodisch Moll (= zusätzliche Erhöhung der 6. Stufe) führte (vgl. zum Ganzen etwa Grabner 1970, S. 62 f.); z um anderen aber durch die Spannung zur irrationalen Melodieführung (MS, S. 821), die nie allein aus der Harmonik zu erklären ist. Diese Spannung zwischen Melodik und Harmonik ist ein grundlegendes Problem der gesamten Musikgeschichte; Weber versteht sie al s eine grundlegende Spannung zwischen Rationalisierung und Irrationalität (MS, S. 821). Man kann sie verstehen als eine diachrone (Tonfolgen) bzw. synchrone (Akkorde, Schichtungen usw.) Blickrichtung in der Musik bzw. eine vertikale und horizontale Sichtweise, wobei die Hellenen – und die meisten der sog. primitiven Musiken – den ersten Weg gegangen sind (Distanzskalen), während die europäische Musik im Mittelalter ein harmonisches Tonsystem begründete und immer weiter versuchte, die melodischen Irr ationalitäten ihrem Einfluß zu unterziehen. Weber zeigt nun anhand der Chromatik auf, wie beide Sichtweisen zu ganz unterschiedlichen, folgenreichen Resultaten führten:
13 Das Prinzip der Tonalität wurde immer wieder polemisch ausgespielt gegen die Atonalität , vgl. dazu Silbermann 1963, S. 450 Anm. 13.„Daß die gleichen Ausdrucksbedürfnisse dort [in Hellas; jum] zu einer Zersetzung der Tonalität, hier […] zur Schaffung der modernen Tonalität führten, lag in der sehr abweichenden Struktur derjenigen Musik, in welche jene Tonbildungen im einen und im anderen Fall eingebettet wurden. Die neuen chromatischen Spalttö ne wurden in der Renaissancezeit als Terzen – und Quintenbestimmte harmonisch gebildet. Die hellenischen Spalttöne dagegen sind Produkte einer rein distanzmäßigen , der exklusiven Pflege melodischer Interessen entsprungenen Tonbildung“ (MS, S. 827; Hervorheb ung von jum) ) – die Distanzen sind hier irrational (a.a.O., S. 827), weil nicht einem einheitlichen Ordnungsprinzip unterworfen. Aber dies ist eben allein vom Standpunkt der »harmonisch rationalisierten okzidentalen Kunstmusik« aus so gesehen: sie ergeben eben kein „harmonisch – rationales, für eine Akkordmusik brauchbares Intervallsystem“ (MS, S. 822).
Die Temperierung versucht dieses Problem durch künstlich gebildete, gleiche Distanzen zwischen den Halbtonschritten zu lösen. Aus dieser Tatsache folgt auch der unterschiedliche Charakter unterschiedlicher Tonarten auf allen temperierten Instrumenten: die Distanz der Funktionstöne zueinander ist in jeder einzelnen Tonart unterschiedlich! Von daher ist der Charakter , das Ethos (MS, S. 823) einer Musik, nur tei lweise ein Werturteil: er ist auch – neben anderen Faktoren (etwa die Tatsache, daß der festliche oder auch kriegerische Charakter einer D – Dur – Tonleiter ursprünglich mit der Verwendung gleichgestimmter Trompeten, die eben zu festlichen oder auch militärisc hen Zwecken verwendet wurden, zusammenhängt) – bedingt durch die unterschiedlichen Distanzen zwischen den Haupttönen in den verschiedenen Tonarten der temperierten Stimmung: 14 diese Unterschiede sind real, weil tonphysikalisch bedingt, subjektiver praktisch er Wertung entspringt die Zuordnung von ästhetischen Kategorien zu diesen Unterschieden. – Es läßt sich also festhalten, daß auch die Temperierung das Problem der rein gestimmten Instrumente nicht gänzlich löst, insbesondere im Zusammenspiel mit Tasteninstrumenten.
Aber – und das ist nun der grundlegende Gedanke – gerade all diese melodischen Irrationalitäten, all diese Spannungen zur akkordharmonischen Rationalisierung, geben dem Fortschreiten in der Musik – Weber meidet hier wie anderswo das geschichtsphi losophisch belastete Wort vom Fortschritt und verwendet es eher unspezifisch (vgl. dazu etwa (MS, S. 862; WL, S. 480) – seine spezifische Dynamik:
„Eben diese akkordfremden Töne sind nun aber naturgemäß, gerade durch den Kontrast gegen das akkordlich Gefor derte, die wirksamsten Mittel der Dynamik des Fortschreitens einerseits, andererseits auch der Bindung und Verflechtung der Akkordfolgen miteinander. Ohne diese durch die Irrationalität der Melodik motivierten Spannungen gäbe es keine moderne Musik …“ (M S, S. 821; Hervorhebung durch jum).
Man vergleiche diesen Satz etwa mit Kaeslers Darstellung 15 oder aber mit Silbermanns „evolutionärer Sicht“ (s.o.)! Es sind dies Deutungen, die an den Text herangetragen sind und keine Basis in der Darstellung selbst haben !
14 Auf Hochdeutsch: ein Dur – Dreiklang setzt sich – tonphysikalisch gesehen – in C – Dur aus anderen Intervallen zusammen als etwa in As – Dur. 15 Kaesler 1998, S. 216 f.: „Alle Feststellungen, die Weber zur Harmonielehre „alter“ und „moderner“ Musik, zur Entstehu ng der Notenschrift und zur Entwicklung des Instrumentenbaus machte, zielten auf den Nachweis einer allmählichen Auflösung mystischer und „irrationaler“ Qualitäten in der Kunst bzw. der Kunstausübung und deren allmähliche Ersetzung durch rationale Muster. Das Hauptergebnis dieser Untersuchung war dabei, daß das Prinzip der simplen Distanz von Tönen untereinander durch das „rationale“ Prinzip der Akkordharmonie abgelöst wurde. Diese Entwicklung interpretierte Weber als Zeichen einer rationalen Mentalität der abendländischen Gesellschaft.“ – Das ist – mit Verlaub! – Unfug. e) Zusammenfassung
Einige wichtige Probleme des Fragments müssen an dieser Stelle unerörtert bleiben: zunächst die Frage nach Freiheit und Ordnung in der Musik. Rationalisierung beinhaltet ja zugleich immer auch einen Freiheitsverlust: Musik ist mehr al s unsere eingeschränkte Sichtweise, die allein die 12tönige temperierte Stimmung zum Maß aller Dinge macht! Weber hat hier keineswegs eine einlinige Sicht! 16 Gerade nicht die fortschreitende Rationalisierung – von der er übrigens sagt, daß sie allein schon in sich bleibende Irrationalitäten beinhaltet (MS, S. 821)! – , sondern die Spannung – man könnte auch sagen: der Kampf, der unversöhnliche Gegensatz (vgl. MS, S. 820) – zwischen Rationalisierung und (bleibender) Irrationalität bewirkt den »Fortschritt« in der Musik und erhält so bleibende Spielräume ! – Des weiteren müssen hier unerörtert bleiben die eigentlich soziologischen Fragestellungen 17 sowie die damit zusammenhängende Frage nach dem Charakter der Schrift: ist sie allein Vorarbeit und Materialsammlung (allerdings mit deutlichen soziologischen Hinweisen, gerade in den Schlußpartien) – so zutreffend Silbermann und Schluchter – oder beinhaltet sie selbst sc hon die geplante Soziologie der Künste (so Kaesler)? Dahinter steht die grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis von Rationalität und Soziologie im Ansatz von Weber (vgl. Anlage III.). – Und auch ein Blick auf die weitere Entwicklung der Musiksoziologie in Deutschland unter dem Einfluß von Theodor W. Adorno muß an dieser Stelle unterbleiben. – 18
Vorrangig wichtig ist im Zusammenhang der Extrakt des Fragments für den Begriff der Rationalisierung. Und hier gilt zunächst generell: Musik unterliegt ihrer eigenen Rationalität, es gibt zur logischen Rationalität allenfalls Analogieverhältnisse (MS, S. 833). Dennoch läßt sich für die musikalische Ratio dasselbe feststellen wie für das (logische) Rationale, daß sie allein im Okzident „ zur bewußten Grundlage des Tonsys tems gemacht worden ist“ (MS, S. 861). Des weiteren läßt sich in dreierlei Hinsicht ein Fortschritt im Rationalisierungsverständnis bei Weber in dieser Schrift gewinnen:
Zur Begrifflichkeit des Rationalisierungskonzepts bei Weber
Zunächst läßt sich in di eser Schrift ein klares Verhältnis zur Begrifflichkeit gewinnen: das ursprüngliche Chaos in der Musik wird – ganz einlinig – durch Rationalisierung zur Rationalität . Das bedeutet: Wenn Weber hier den Begriff rational verwendet, bezeichnet er durchgängig da s Ergebnis eines Rationalisierungsprozesses: das „rationale[.] Resultat“ (MS, S. 858).
Sehr deutlich sieht man dies im folgenden Zitat: „ An Stelle des tippenden Anschlags bei den Tasteninstrumenten des 16. Jahrhunderts war, von der Orgel aus, schon für d as Cembalo eine rationale Fingersatztechnik in der Entwicklung begriffen, freilich mit ihrem Ineinandergreifen der Hände und Übereinandergreifen der Finger für unsere Begriffe noch kraus und halsbrecherisch genug, bis die beiden Bach sie, durch Einfügung e iner rationalen Verwendung des Daumens, auf eine, man möchte sagen: physiologisch »tonale« Grundlage stellten.“ (MS, S. 868). Rational bedeutet hier soviel wie rationell (MS, S. 864), also praktisch ; Bachs Innovation des Daumenuntersetzens beinhaltet dabei den entscheidenden Rationalisierungsschritt. Und zugleich wird deutlich, daß diese Rationalisierung nach ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten geschehen kann, wie hier hinsichtlich der Physiologie.
Zugleich belegt das Zitat aber noch etwas anderes: im » evolutionären« Prozeß der Rationalisierung ist die Rationalität dann wiederum auch Voraussetzung der Rationalisierung: verschiedenen Formen der Rationalität entsprechen unterschiedliche Plateaus , Stufen bzw. Niveaus (vgl. MS, S. 851); so etwa die Entwicklu ng der rationalen modernen Notenschrift als Ergebnis von Rationalisierungen (Neumen, Mensural – Notation), die Weber als technisch bezeichnet (MS, S. 852)! – Weber urteilt hier durchgängig vom Standpunkt der europäischen musikalischen Rationalität in ihrer u m die Jahrhundertwende gültigen Form – also vor der sog. atonalen Musik; von diesem Gesichtspunkt aus ergeben sich dann einzelne, abgestufte Formen der Rationalität:
- Die Musik der sog. Primitiven , „d.h. tonal nicht oder wenig rationalisierte Musiken“ (MS, S. 823. 824); sie ist dennoch kein „Chaos regelloser Willkür“ (MS, S. 830);
- partiell rationalisierte Tonskalen , wie etwa die Pentatonik (MS, S. 824), die bereits „ eine Art von Auslese rationaler harmonischer Intervalle aus der Fülle der melodischen Distan zen“ darstellen (MS, S. 826), oder:
- die Entwicklung der rationalen Notenschrift (MS, S. 852 ff.)